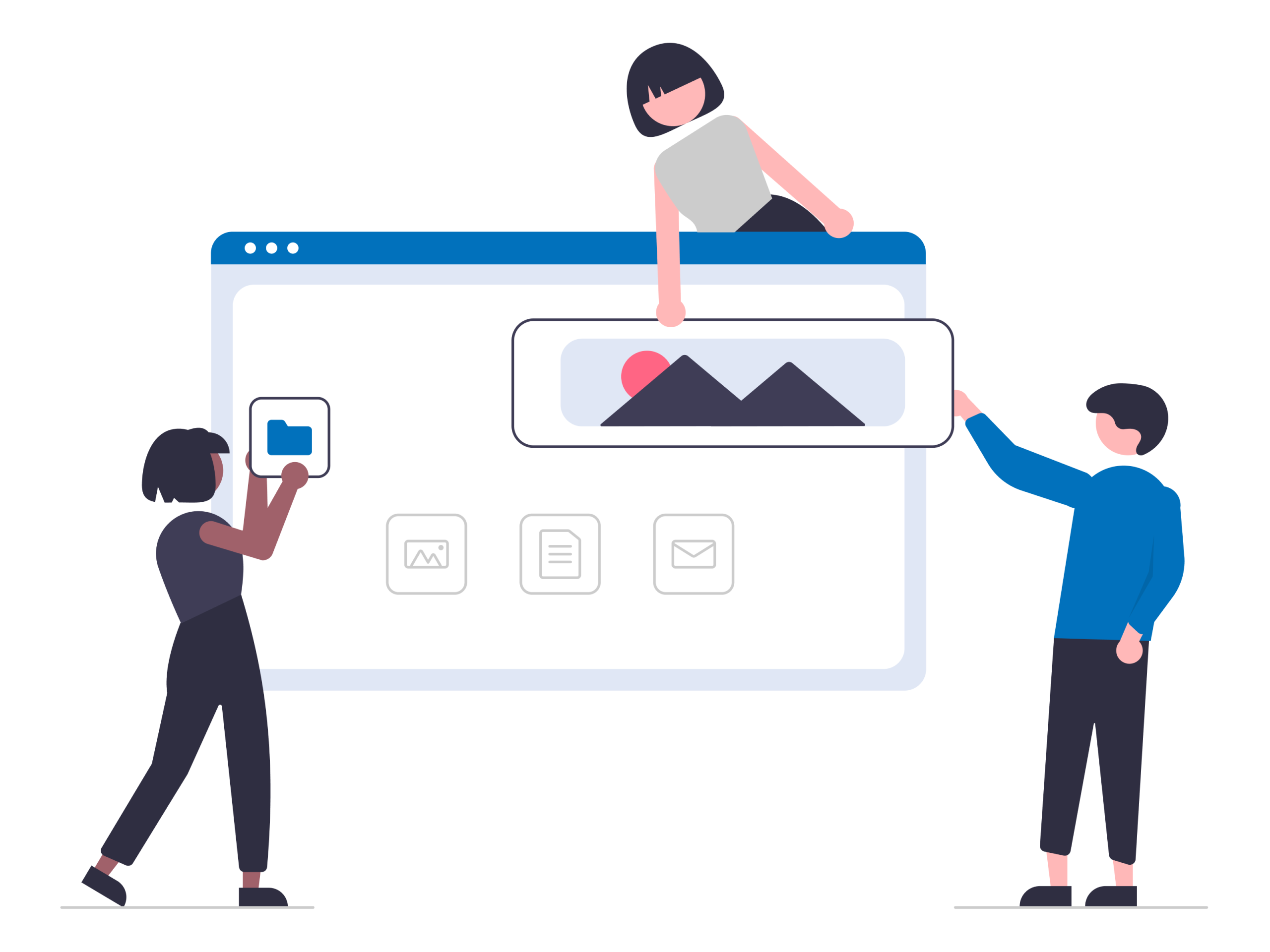
Nutzungsverhalten
Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernbehinderung nutzen das Internet sehr vielfältig. Sie unterscheiden sich darin, welche Geräte sie verwenden, welche Tätigkeiten sie ausführen und welche Hilfsmittel sie einsetzen. Im Projekt haben wir diese Vielfalt untersucht, um ein klareres Bild der digitalen Teilhabe zu gewinnen.
Genutzte Endgeräte

Smartphones
Viele Menschen mit geistiger oder Lernbehinderung nutzen hauptsächlich oder ausschließlich ihr Smartphone, um ins Internet zu gehen. Das hat zwei Gründe: Zum einen ist ein Smartphone oft das einzige digitale Gerät, das sie sich leisten können – ein zusätzlicher Computer oder Laptop ist meist zu teuer. Zum anderen fällt die Bedienung am Smartphone oft leichter, da Apps übersichtlicher sind und keine langen Eingaben wie im Browser nötig sind.
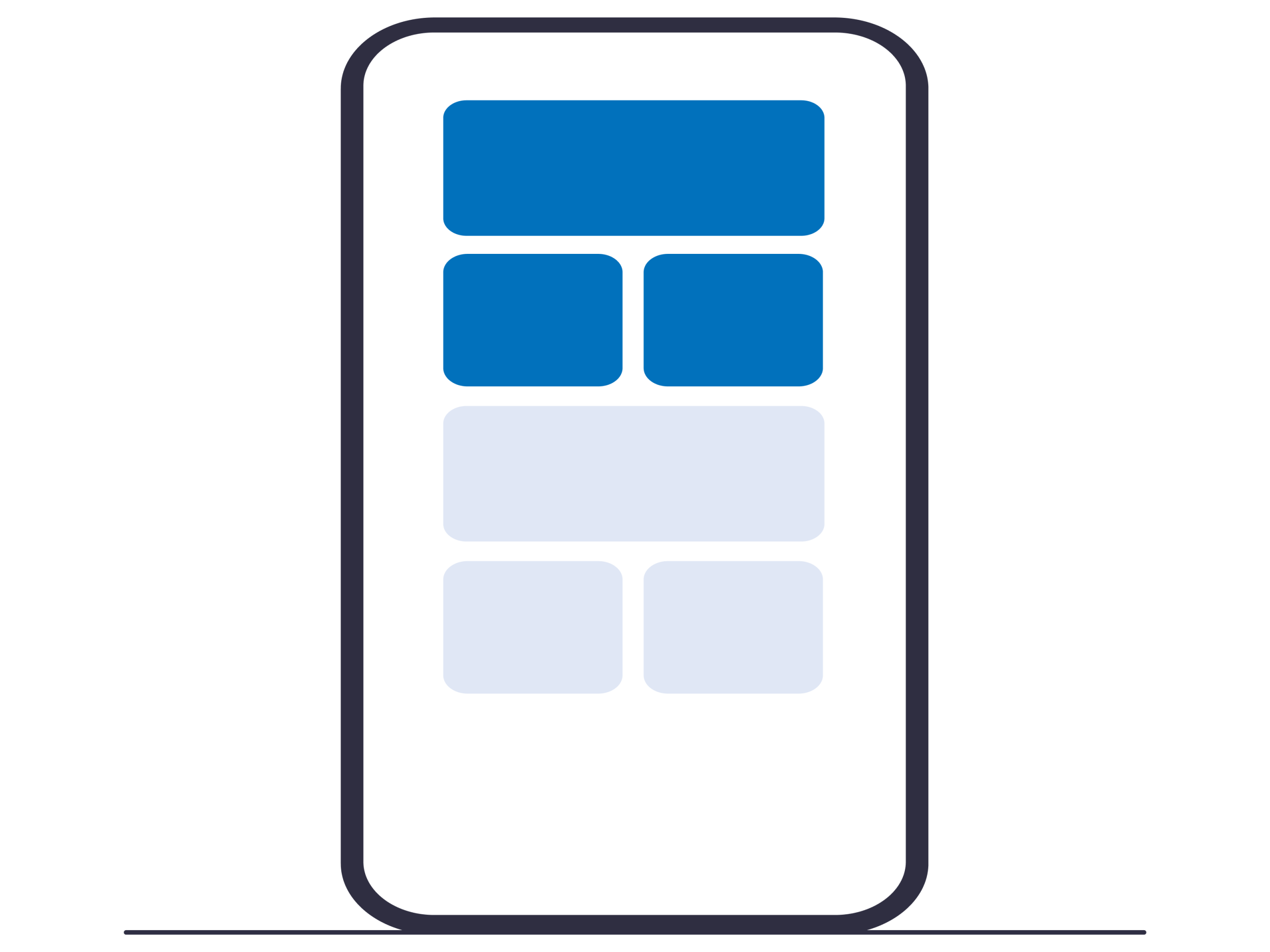
Tablets
Tablets sind bei vielen Nutzer:innen beliebt, weil sie eine größere Darstellung als das Smartphone bieten und einfacher zu bedienen sind als ein Computer. Für Menschen mit motorischen Einschränkungen sind die größeren Touchflächen hilfreich. Auch Menschen, die beim Lesen Schwierigkeiten haben, profitieren von der größeren Schrift und der übersichtlicheren Darstellung. So ermöglichen Tablets den Zugang zu Informationen, Videos und Apps in einem gut handhabbaren Format.
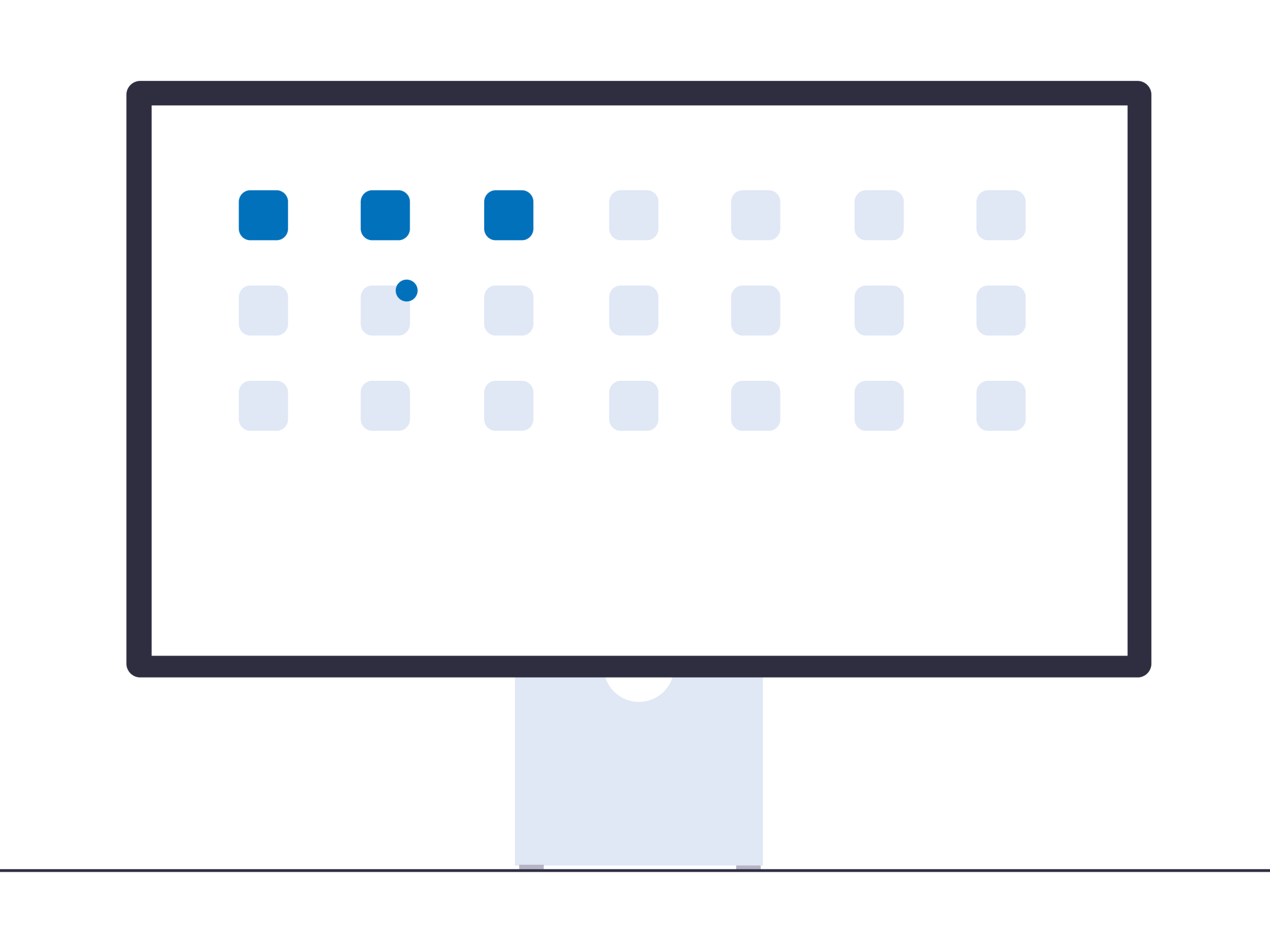
Laptops/Computer
Laptops oder stationäre Computer werden nur von wenigen Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernbehinderung genutzt. Die Bedienung mit Maus und Tastatur fällt schwer, und die komplexe Navigation im Browser kann schnell überfordern. Außerdem fehlt in vielen Wohngruppen oder zu Hause der Zugang zu solchen Geräten.
Typische Tätigkeiten im Internet
Was die Nutzung prägt
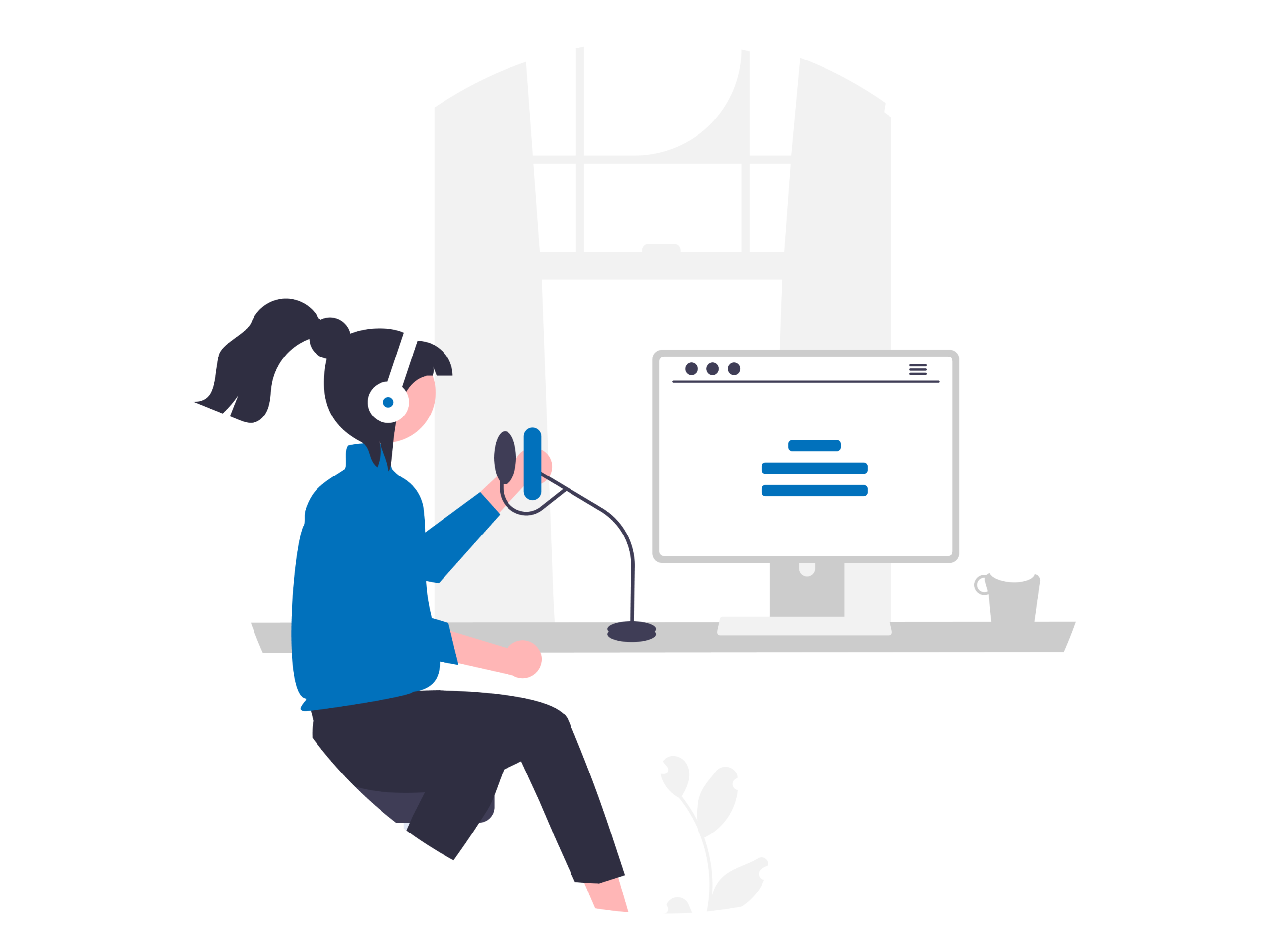
Unterschiedliche Voraussetzungen
Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernbehinderung bringen ganz verschiedene Fähigkeiten und Kenntnisse mit – zum Beispiel beim Lesen, Schreiben, in der Konzentration oder bei der Motorik. Diese Vielfalt prägt die digitale Nutzung und zeigt: Eine Einheitslösung funktioniert nicht, Angebote müssen flexibel und verständlich gestaltet sein.

Einfluss des Umfelds
Nicht nur persönliche Fähigkeiten zählen, auch das Umfeld spielt eine große Rolle. Entscheidend sind etwa: Verfügbarkeit von Geräten und Internet, frühere Erfahrungen mit Technik, Motivation, Unterstützung durch Angehörige oder Betreuer:innen sowie passende Lernangebote. All das bestimmt, wie selbstbewusst Menschen digitale Angebote nutzen können.
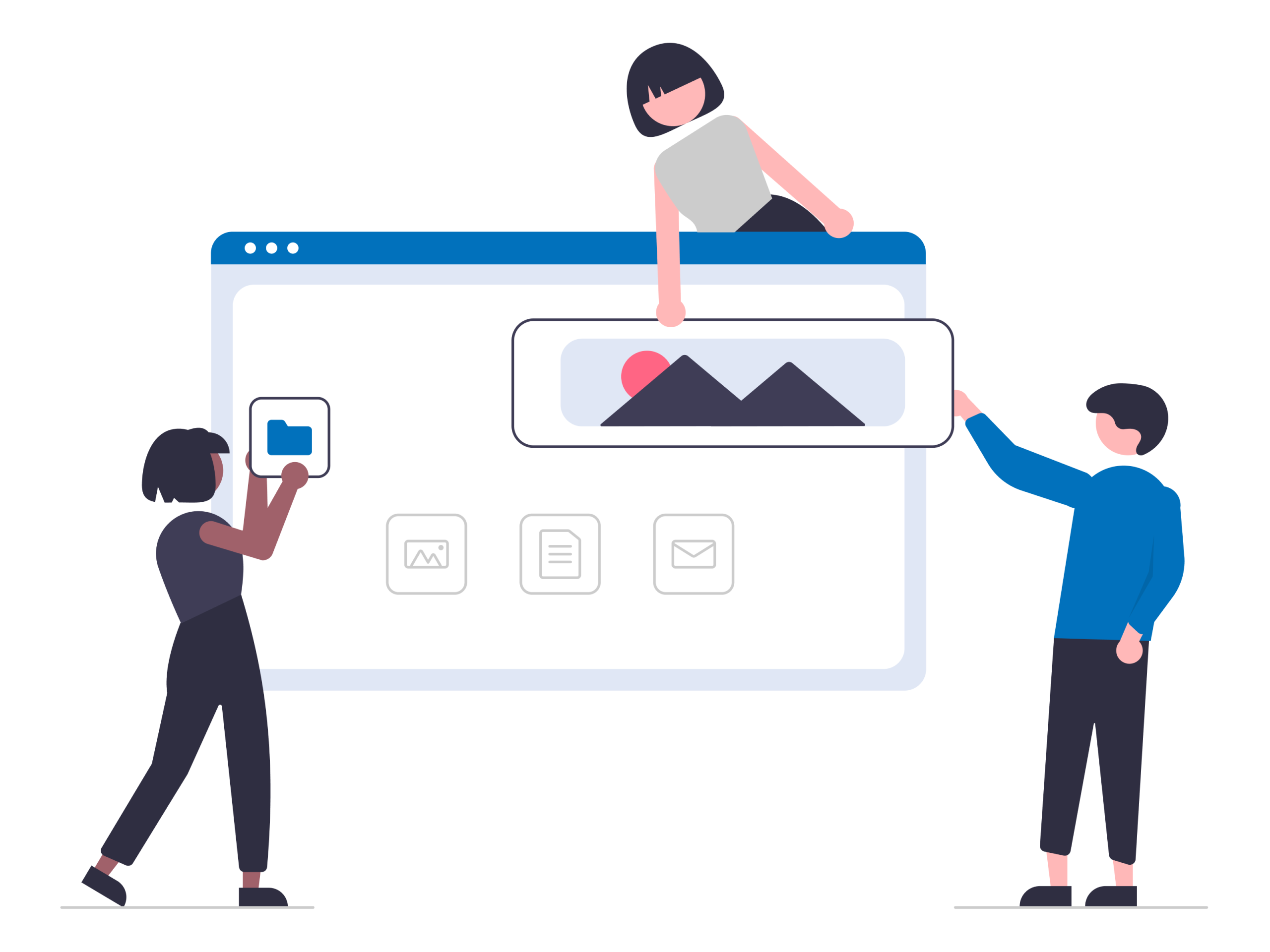
Digitale Hilfsmittel
Funktionen wie Spracheingabe oder Vorlesetools können Barrieren abbauen. Manche nutzen sie regelmäßig, andere kennen sie kaum oder trauen sich nicht, sie einzusetzen. Wichtig ist: Hilfsmittel müssen leicht zugänglich und einfach erklärt sein – dann entfalten sie ihr Potenzial.

Bedeutung des persönlichen Kontakts
Trotz aller Technik bleibt der direkte Austausch wichtig. Viele greifen im Zweifel lieber zum Telefon oder fragen Menschen vor Ort, statt digitale Dienste zu nutzen. Digitale Angebote sollten das nicht ersetzen, sondern dort unterstützen, wo sie Sicherheit und Eigenständigkeit fördern.
